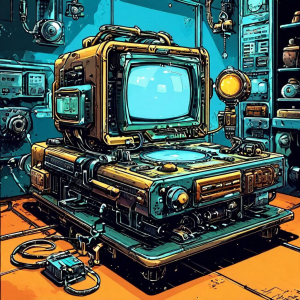So entschieden durch das Gericht in seinem Urteil vom 15. Februar 2024 (Az.: 2 Ca 4416/23) in einem Rechtsstreit eines Stellenbewerbers mit dem stellenausschreibenden Unternehmen. Der Kläger hatte mit seinen letzten Anträgen unter anderem einen Anspruch nach Art. 82 DSGVO geltend gemacht und dabei einen Mindestschaden von 2.000 EUR geltend gemacht. Das Gericht vereinte den Anspruch unter anderem wegen des nicht ausreichenden Vortrages eines eingetretenen Schadens unter Berücksichtigung von Rechtsprechung des EuGH. Es wird in den Entscheidungsgründen unter anderem folgendes ausgeführt:
„…Der Kläger beruft sich vornehmlich auf einen Kontrollverlust hinsichtlich seiner persönlichen Daten durch die nicht rechtzeitige Auskunftserteilung der Beklagten nach Artikel 15 DS–GVO. Zwar kann auch ein bloßer Kontrollverlust aufgrund der nicht vorhandenen Erheblichkeitsschwelle einen Schaden i.S.v. Artikel 82 Abs. 1 DS-GVO darstellen. Da es sich bei dem Schaden jedoch um ein echtes Tatbestandsmerkmal handelt, kann es für eine Anspruchsgrundlage nicht ausreichen, den Kontrollverlust lediglich pauschal zu behaupten. Ein Tatbestandsmerkmal, das Rechtsfolgen auslöst, zeichnet sich dadurch aus, dass es bestimmte Voraussetzungen hat, die einer rechtlichen Überprüfung zugänglich sind. Daher genügt es nicht, nur einen Kontrollverlust anzuzeigen, ohne auf die konkreten Umstände einzugehen, wann dieser wie eingetreten ist und sich in welchem Umfang und bis zu welchem Zeitpunkt (nachgeholte Auskunftserteilung?) auswirkt. Die Darlegung der Voraussetzungen eines echten Tatbestandsmerkmals, das eine Rechtsfolge auslöst, erfordert mehr als bestimmte von der Rechtsprechung angeführte Beispielsfälle einfach nur zu zitieren. Denn dann würde der Anspruch auf einen Schadensersatzanspruch nach Artikel 82 Abs. 1 DS–GVO allein davon abhängen, ob der jeweilige Kläger in der Lage ist, ein von der Rechtsprechung genanntes Regelbeispiel für einen Schaden als Schlagwort aus den Urteilsgründen herauszukopieren oder abzuschreiben.
Entgegen der vom Kläger im Termin zur mündlichen Verhandlung geäußerten Rechtsauffassung stellt sich die Rechtslage auch bei Verletzung des Auskunftsanspruchs nach Artikel 15 Abs. 1 und 3 DS–GVO nicht anders da. Zwar ist offensichtlich, dass bis zu einer entsprechenden Auskunftserteilung die spätere Klagepartei keine Kenntnis von der Verwendung und Verarbeitung der überlassenen personenbezogenen Daten hat. Wenn es nicht gleichwohl der konkreten Darlegung eines Schadens und der Kausalität bedürfte, wäre der Verstoß gegen die Auskunftsverpflichtung aus Artikel 15 DS–GVO stärker sanktioniert als gegen jede andere schwerwiegendere Verletzung nach demselben Regelwerk wie zum Beispiel die illegale Weitergabe persönlicher Daten an Dritte oder der unkontrollierte Verlust personenbezogener Daten. Der EuGH differenziert allerdings nicht zwischen den verschiedenen Rechtsverstößen gegen Vorschriften der DS-GVO. Daher bedarf es auch bei einer Verletzung der Auskunftspflicht nach Artikel 15 DS-GVO der Darlegung aller Tatbestandsvoraussetzungen. Das Bedürfnis für eine Ausnahme ist nicht erkennbar.
Im Ergebnis stellt ein bloßer, abstrakter Kontrollverlust des Klägers keinen konkreten immateriellen Schaden dar…“
Hinweis des Autors:
Die Entscheidung ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrages nicht rechtskräftig.