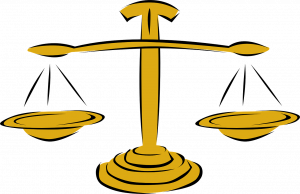So das Gericht in seinem Urteil vom 12. Dezember 2024 (Az.: 6 U 153/22) in einem Rechtsstreit eines qualifizierten Wirtschaftsverbandes mit einem Hersteller von Kosmetikprodukten, der etliche Produkte mit einer UVP von 100 EUR angegeben hatte. Diese UVP wurde auch von diversen Verkäufern der Produkte in der Preiswerbung genutzt. Der Hersteller selbst verlangte für Produkte über einen konstanten Zeitraum einen Verkaufspreis von 69,80 EUR. Darin sah das Gericht eine Irreführung im Sinne des § 5 UWG und damit auch einen Unterlassungsanspruch. In den Entscheidungsgründen des Urteils heißt es zur Begründung unter anderem:
„…Der von der Beklagten gemeldete AVP war nicht auf Grundlage einer ernsthaften Kalkulation ermittelt. Zum „Mondpreis“ wird ein empfohlener Preis zwar noch nicht bereits dadurch, dass er über dem normalen Verkaufspreis liegt. Einen empfohlenen Preis für Uhren, der 100 % über dem Händlereinkaufspreis lag, hat der BGH jedoch als „Mondpreis“ beurteilt (BGHZ 45, 115, 128 – Richtpreiswerbung I). Im Allgemeinen ist die Höhe der Spanne jedoch nur ein Indiz für einen Fantasiepreis; entscheidend ist die konkrete Wettbewerbslage auf dem relevanten Markt, die je nach Branche, Zeitpunkt und Wettbewerbsintensität sehr verschieden sein kann. Daher müssen auch hohe Handelsspannen die Marktbedeutung einer Preisempfehlung nicht ausschließen. So ist z.B. ein von 50 % der Händler eingehaltener, unverbindlich empfohlener Wiederverkaufspreis nicht als Mondpreisempfehlung ohne Marktbedeutung angesehen worden, obwohl er dem Einzelhändler einen Aufschlag von ca. 150 % auf den tatsächlich gewährten Großhandelsabgabepreis ermöglichte (BGH GRUR 1981, 137, 139 – Tapetenpreisempfehlung).
Danach ist ein Mondpreis hier zu bejahen. Die Beklagte hat zwar Markübersichten vorgelegt (Anlagen B 2, Bl. 77 ff. und B 3, Bl. 166 ff., eine Marktübersicht für die fünf exemplarischen Produkte (…), (…), (…), (…), (…)), aus denen sich für stationäre Apotheken eine Preisspanne von ca. 95 – 113 € ermittelt. Entscheidend ist hier jedoch, dass die Beklagte diesen AVP nicht nur selbst nie gefordert hat, sondern dauerhaft ganz erheblich unterboten hat. Der Kläger hat vorgetragen, der von der Beklagten in ihrem Online-Shop verlangte Preise liege kontinuierlich mindestens 1/3 unter dem AVP, zeitweise sogar 50 %. Die Beklagte hat dies zwar bestritten, aber unzulässigerweise nur einfach, so dass der Senat dies als unstreitig zu behandeln hat. Jedenfalls durch die Tatsache, dass die Beklagte ¾ ihres Umsatzes mit dem Online-Verkauf in ihrem eigenen Shop erzielt und nur der Rest über stationäre oder Online-Apotheken angeboten wird, kann eine ernsthafte Kalkulation nicht bejaht werden. Weiß der Hersteller von vorneherein, dass der UVP/AVP von vorneherein nur bei ca. ¼ der verkauften Menge überhaupt eine Wirkung entfalten kann – weil er den Rest selbst kontinuierlich erheblich unter dem UVP/AVP – verkauft, kann der gewählte UVP nicht das Ergebnis einer ernsthaften Kalkulation sein, sondern ist vielmehr das Ergebnis einer Mondpreis-Strategie, die eine Rabattierung suggerieren soll, die es in Wirklichkeit so gar nicht gibt…“