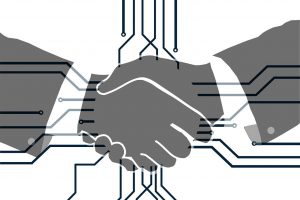So das Gericht in seinem Urteil vom 15. Januar 2025 (Az.: 1 U 20/24) in einem Rechtsstreit einer Ehefrau mit einer Versicherung um Ansprüche aus einem Versicherungsfall. Der „Clou“ des Falls war, dass der Ehemann mit der Versicherung bereits einen umfassenden Vergleich abgeschlossen und dazu eine E-Mail im Namen der Klägerin über deren E-Mail-Account geschickt hatte. Zu diesem hatte der Ehemann Zugriff, dass Passwort und über einen längeren Zeitraum hinweg darüber für die Ehefrau private und geschäftliche E-Mails in deren Namen verschickt. So konnte die beklagte Versicherung, so das Gericht, von einer Anscheinsvollmacht und damit einer wirksamen Stellvertretung bei Abschluss des Vergleichs ausgehen. Auch aus diesem Grund wurde die Klage abgewiesen. Das Gericht führt in den Entscheidungsgründen zur Begründung unter anderem aus:
„…Dieses Angebot stammte von der Klägerin. Deren Einwand, nicht sie selbst, sondern ihr Ehemann habe ohne ihr Wissen und ohne entsprechende Absprache mit ihr die Mail eigenmächtig verfasst, ist unbehelflich.
Wird – wie in Streitfall – bei der Abgabe einer Willenserklärung durch die Nutzung eines fremden Namens beim Geschäftspartner der Anschein erweckt, der angebotene Vertrag solle mit dem Namensträger zustande kommen (E-Mail Account der Klägerin, Unterschrift der Versicherungsnehmerin … …) und wird dabei eine falsche Vorstellung über die Identität des Handelnden hervorgerufen, so finden die Regeln über die Stellvertretung (§§ 164 ff. BGB) und die hierzu entwickelten Grundsätze entsprechend Anwendung. Dies gilt auch für Geschäfte, die über das Internet abgewickelt werden. Eine rechtsgeschäftliche Erklärung, die unter solchen Voraussetzungen unter dem Namen eines anderen abgegeben worden ist, verpflichtet den Namensträger dann, wenn sie in Ausübung einer bestehenden Vertretungsmacht erfolgt (§ 164 Abs. 1 Satz 1 BGB analog), vom Namensträger nachträglich genehmigt worden ist (§ 177 Abs. 1 BGB analog) oder wenn die Grundsätze über die Anscheins- oder Duldungsvollmacht eingreifen (BGH, Urteil vom 11.05.2011, Az. VIII ZR 289/09, Rn. 12, Juris). Hieran gemessen ist der Klägerin das Angebot vom 13.06.2014 zuzurechnen.
Zwar hat die Klägerin, wenn man ihren Angaben folgt, ihren Ehemann weder im Vorfeld zur Abgabe einer entsprechenden Willenserklärung bevollmächtigt noch dessen Verhalten nachträglich genehmigt. Die gegenteilige Auffassung des Vorderrichters, die Klägerin habe nachträglich das Vergleichsangebot vom 13.06.2014 konkludent genehmigt, indem sie den Geldbetrag behalten habe, nachdem ihr Ehemann ihr zu dem festgestellten Geldeingang erklärt habe, dies stelle die Entschädigung der Beklagten für den Leitungswasserschaden dar, überzeugt nicht. Denn allein aufgrund des der Klägerin bekannt gewordenen Umstandes, dass ihr Ehemann mit dem Gutachter … telefoniert hatte und es sich bei den von der Beklagten überwiesenen 10.000 € um den Regulierungsbetrag der Versicherung handele, musste sich ihr weder erschließen, dass mit dem Regierungsbetrag ein Vergleich geschlossen worden war, noch, dass damit auch mögliche Folgeschäden abgegolten sein würden. Auch die Hilfserwägung im angefochtenen Urteil, dass in dem Schreiben der Beklagten vom 04.07.2014 („Sehr geehrte Frau …! Sie erhalten von uns eine Restentschädigung von 10.000,00 EUR. Wir haben diesen Betrag auf ihr Konto überwiesen. (…) Die Regulierung erfolgt gemäß den Feststellungen des Sachverständigen vor Ort.“) ein eigenes Angebot auf Abschluss eines Abfindungsvergleichs gesehen werden könne, das die Klägerin konkludent durch das Behalten des Abfindungsbetrages angenommen habe, trägt nicht. Die angefochtene Entscheidung enthält bereits eine unzulässige Sachverhaltsunterstellung, soweit ausgeführt wird, die Beklagte habe der Klägerin mit ihrem Schreiben vom 04.07.2014 ein eigenes, „auf der E-Mail vom 13.06.2014 beruhendes“ Angebot gemacht. Tatsächlich enthält das Schreiben der Beklagten vom 04.07.2014 keine Bezugnahme auf die Mail vom 13.06.2014. Zudem lässt sich auch dem Schreiben vom 04.07.2014 nicht mit der erforderlichen Gewissheit entnehmen, dass mit der Zahlung weiterer 10.000 € etwaige künftige Folgeschäden abgegolten sein sollten.
Allerdings steht nach der ergänzenden Anhörung der Klägerin fest, dass diese nach Rechtsscheingrundsätzen – dies in Form einer Anscheinsvollmacht – für das unter Verwendung ihres passwortgeschützten E-Mail Accounts am 13.06.2014 abgegebene Angebot ihres Ehemanns auf Abschluss eines Abfindungsvergleichs einzustehen hat. Von einer Anscheinsvollmacht ist nach herkömmlicher Rechtsprechung auszugehen, wenn der Vertretene das Handeln des Scheinvertreters nicht kennt, er es aber bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen und verhindern können, und wenn der Geschäftspartner annehmen durfte, der Vertretene kenne und billige das Handeln des Vertreters. Dabei greifen die Rechtsgrundsätze der Anscheinsvollmacht in der Regel nur dann ein, wenn das Verhalten von gewisser Dauer und Häufigkeit ist (vgl. BGH, Urteil vom 11.05.2011, Az. VIII ZR 289/09, Rn. 16, Juris). Diese Voraussetzungen liegen für den Streitfall vor.
Aus objektiver Sicht des Erklärungsempfängers lag ein Angebot der Klägerin als der materiell Berechtigten vor, welches die Beklagte angenommen hatte. Das Angebot kam vom E-Mail Account der Klägerin und war mit Ihrem Namen unterzeichnet. Die Beklagte wurde dabei über die Identität des Handelnden getäuscht. Aus ihrer Sicht wollte sie den angebotenen Abfindungsvergleich ausschließlich mit der Klägerin als ihrer Versicherungsnehmerin schließen. Den falschen Anschein hatte die Klägerin gesetzt; dies in Form der Aushändigung von Legitimationsmerkmalen durch Preisgabe ihres Passworts für die Nutzerkennung (vgl. BGH, Urteil vom 11.05.2011, Az. VIII ZR 289/09, Juris: Leupold/Wiebe/Glossner, IT-Recht, 4. Aufl. 2021 Teil 5.1 Rn. 115 m.w.N.) Die Klägerin hat im Rahmen ihrer ergänzenden Befragung ausdrücklich eingeräumt, dass sie ihrem Ehemann die Zugangsdaten ihres passwortgeschütztes E-Mail Kontos willentlich offengelegt und dieser in der Vergangenheit häufig im Privat- wie Geschäftsverkehr ihr E-Mail Konto genutzt hatte, um in ihrem Namen rechtsgeschäftliche Erklärungen abzugeben. Umgekehrt habe auch sie die passwortgeschützten Zugangsdaten für das E-Mail Konto ihres Mannes gekannt und dieses in gleicher Weise genutzt. Man habe da nicht unterschieden, wer welches E-Mail Konto nutze. Die Klägerin hätte indes unschwer erkennen können, in welcher Weise ihr Ehemann ihren E-Mail Account nutzte und welche Mails er unter ihrem Namen an wen verschickte…“